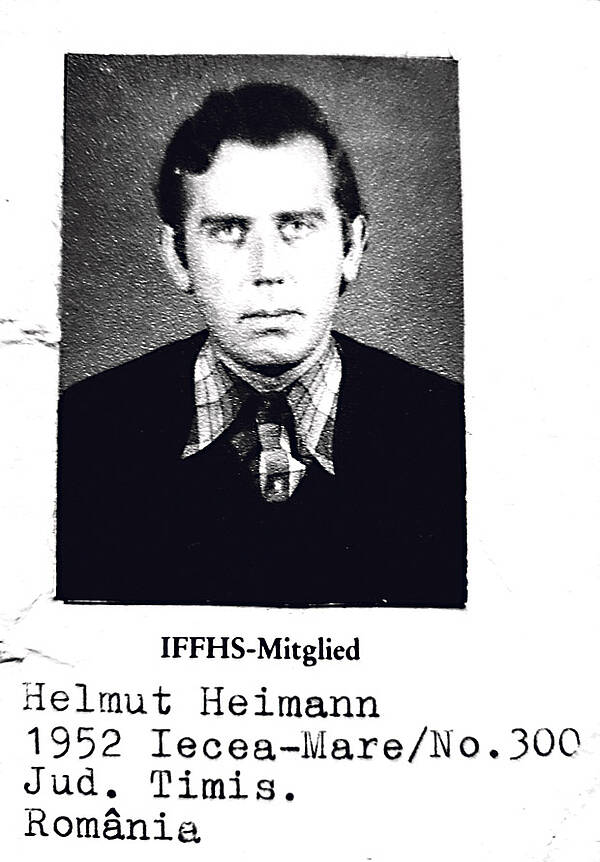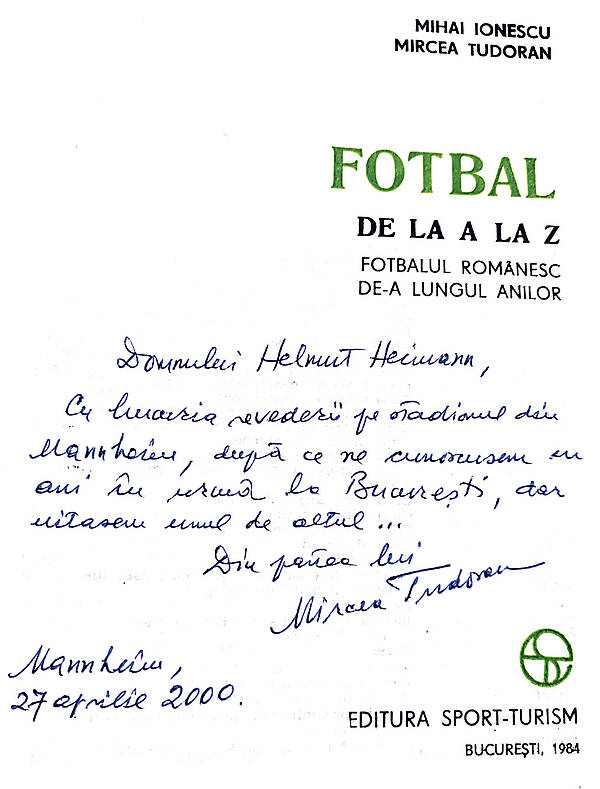Nach der Ausreise im Juni 1990 beabsichtigte ich, meine journalistische Tätigkeit in Deutschland fortzusetzen. Doch leicht war es nicht, weil niemand hier auf Journalisten aus Rumänien gewartet hat. Zuerst musste ich das Tippen mit allen zehn Fingern an der Schreibmaschine lernen. Bei der NBZ haben wir unsere Berichte vorwiegend von Hand geschrieben, eine Daktylographin tippte sie ab. Die Sportergebnisse sammelte ich per Telefon ein, rechnete die Tabellen mit dem Bleistift aus und überprüfte sie anschließend. Was für Zeiten!
In Deutschland brachen ganz andere an. Ich meldete mich beim Arbeitsamt zu einem Kurs für Textverarbeitung an, war der einzige Mann unter 25 Frauen. Auf der täglichen Fahrt von Wiesloch zum Lehrgang nach Heidelberg las ich BILD in der Straßenbahn und entdeckte eine Anzeige, in der Sportredakteure gesucht wurden. Ich bewarb mich, reiste zum Vorstellungsgespräch nach Hamburg und wurde neun Monate nach der Ankunft in Deutschland am 1. März 1991 als Sportjournalist bei BILD angestellt. Den neunmonatigen Kurs in Heidelberg durfte ich nach fünf Monaten abbrechen, weil ich eine Arbeitsstelle gefunden hatte. In dieser kurzen Zeit war ich auf 150 Schreibmaschinenanschläge pro Minute gekommen.
Behilflich beim Bewerbungsgespräch waren mehrere meiner NBZ-Beiträge, die ich als Textproben in die Zentralredaktion nach Hamburg mitgenommen hatte. Seinerzeit legte ich in Rumänien jede Zeitung ab, in der etwas von mir erschienen ist. Einige Tage vor der Ausreise schnitt ich alle Berichte aus, klebte sie chronologisch auf, notierte die jeweilige Zeitungsnummer mit Erscheinungsdatum auf die Ausschnitte. Eine Sisyphusarbeit. Doch sie hat sich ausgezahlt. Offensichtlich wurde bei der NBZ gute Arbeit geleistet. Sonst hätte ich die Stelle nicht bekommen. BILD hatte damals eine tägliche Auflage von 4,5 Millionen Exemplaren – Rang eins unter den Tageszeitungen in Europa und Platz drei in der Welt!
Der erste Fußballtrainer, mit dem ich es in Deutschland beruflich zu tun bekam, war Klaus Toppmöller: 204 Bundesligaspiele für den 1. FC Kaiserslautern, 108 Tore, dreifacher Nationalspieler. Waldhof Mannheim verpflichtete ihn 1991. Damals spielten die Kurpfälzer in der 2. Liga, ich berichtete für BILD über sie. In den zwei Jahren unserer Zusammenarbeit entwickelte sich ein so großes Vertrauensverhältnis, dass mir Toppi eines Tages sagte: „Sie können mich zitieren, ohne vorher anzurufen.“ Ich wusste genau, wie er tickt und habe sein Vertrauen nie missbraucht. Sonst wäre es so gekommen wie bei Otto Rehhagel. In den vierzehn Jahren seiner Trainertätigkeit bei Werder Bremen hat er mit keinem BILD-Redakteur aus der Weserstadt gesprochen. Wenn man bedenkt, dass die Bundesligareporter der Stadtausgaben von BILD jeden Tag bei ihrem Verein präsent sein müssen, egal, ob Spiel, Pressekonferenz oder Training, war das für die betroffenen Journalisten alles andere als leicht. Doch sie haben es überlebt. Ein ehemaliger Kollege von BILD-Stuttgart hat öfters gesagt: „Trainer sind vorübergehende Erscheinungen, die Zeitung bleibt.“ Bingo! Von Waldhof wechselte Toppi als Trainer zu Eintracht Frankfurt und wurde mit den Hessen Herbstmeister in der Bundesliga. Den VfL Bochum führte er erstmals in den UEFA-Cup. Mit Bayer Leverkusen wurde er in einer einzigen Saison gleich dreimal Zweiter: in Bundesliga, DFB-Pokal sowie Champions League, weshalb die Mannschaft „Vizekusen“ genannt wurde. In jenem Jahr 2002 wählten die Sportjournalisten, darunter auch ich, Toppmöller bei der Umfrage des „kicker“ als ersten Fußball-Lehrer überhaupt zu Deutschlands Trainer des Jahres. Mit dem Hamburger SV erreichte er Platz acht. Dann wurde er Nationaltrainer von Georgien. Sein Kollege Matthias Sammer vom VfB Stuttgart hatte die Angewohnheit, seine Handynummer keinem Journalisten zu geben. Wer ihn sprechen wollte, musste sich an die VfB-Pressestelle wenden, die Sammers Antworten besorgte.
Als Reporter muss man ein sehr gutes Netzwerk und ebensolche Informanten haben. Auch deren Vertrauen darf nicht missbraucht werden, sonst hat man einmal eine gute Geschichte – und dann nie wieder. Als sich der SSV Ulm in der Spielzeit 1998/99 anschickte, in die Bundesliga aufzusteigen, enthüllte ich kurz nach Saisonbeginn exklusiv für BILD nicht nur die detaillierten Prämienregelungen der Spieler in der 2. Bundesliga, sondern auch die eventuelle Aufstiegsprämie unter der Schlagzeile „Reichlich Futter für die Spatzen“, wie die Ulmer bezeichnet werden. Üblich ist, dass die genaue Summe erst kurz vor oder nach dem Aufstieg von den Medien recherchiert wird, ich hatte es bereits zehn Monate vorher geschafft, und die anderen Zeitungen mussten nachziehen. Ulms Vereinsfunktionäre waren perplex. Denn Prämienregelungen werden streng geheim in den Verträgen festgeschrieben. Die SSV-Bosse ließen alle Spieler antanzen und fragten jeden Einzelnen, wer mir die Summen genannt hat. Vergebens! Beim nächsten Heimspiel kam Trainer Ralf Rangnick freundlich auf mich zu, legte seinen Arm um meine Schultern und fragte grinsend: „Wer hat Ihnen die Zahlen genannt?“ Ich antwortete: „Das darf ich nicht sagen. In Deutschland leitet sich der Informantenschutz direkt von Artikel fünf des Grundgesetzes ab und hat somit quasi Verfassungsrang.“ Rangnicks Klappe fiel herunter, und ich habe ihn in meinem Beisein nie mehr lächeln sehen. Der damalige Ulmer Abteilungsleiter Rolf Zanchettin rief mich in der Stuttgarter Redaktion an und warf mir vor: „Sie veröffentlichen doch auch nicht Ihr Gehalt in der Zeitung.“ Worauf ich ihm entgegnete: „Ich bin ja auch keine Person des öffentlichen Lebens wie Ihre Fußballer.“ In der Bundesliga dreht sich alles ums Geld, aber keiner möchte darüber reden. Grotesk! Vom amerikanischen Schriftsteller Mark Twain stammt der Spruch: „Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir.“
In den mehr als zwei Jahrzehnten bei BILD habe ich unzählige Interviews geführt, unter anderem mit Sepp Blatter am FIFA-Stammsitz in Zürich. Doch selbst der mächtige frühere Präsident des Fußball-Weltverbandes ist nicht auf die absurde Idee gekommen, sein Interview vor dem Erscheinen autorisieren zu lassen. Diesen Bruch eines journalistischen Grundsatzes gibt es erst seit circa zwölf Jahren. Dabei muss jedes Interview, egal ob aus Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft oder einem anderen Bereich vor dem Erscheinen der jeweiligen Presseabteilung vorgelegt werden, die es zurechtstutzt. Dieser Vorgang heißt Autorisierung und ist im Grunde genommen eine Zensur. Dabei werden brisante Aussagen so entschärft, dass das Interview für den Leser uninteressant wird. Deshalb hat „DIE ZEIT“ bei einem Interview mit DFB-Manager Oliver Bierhoff die verstümmelten Antworten weggelassen und nur die Fragen abgedruckt.
„Heute wird man durch eine unglaubliche Zensur zu einem Verlautbarungsjournalisten degradiert“, erklärte „kicker“-Chefredakteur Rainer Franzke. Oskar Beck, der renommierte Sportkolumnist von „Stuttgarter Zeitung“ und „Die Welt“, setzte noch einen drauf: „Was von der Presseabteilung als Interview genehmigt schließlich zurückkommt, ist schlimmstenfalls geändert, glattgeschliffen und hochgehübscht. Ein brisantes Interview geht, salopp auf Deutsch gesagt, heutzutage den Weg aller schmutzigen Wäsche – es wird geschleudert, bis es blütenweiß aus der Waschmaschine wieder rauskommt.“ So wurde ein Interview mit Nationalspieler Lukas Podolski gleich an 38 (!) Stellen verändert. Beck vergleicht die Autorisierer mit Frisören: „Sie frisieren die Interviews mit der Heckenschere.“ Der ehemalige Ressortleiter der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Harald Pistorius erläuterte: „Zitate werden kontrolliert, der direkte Kontakt zu Spielern beschränkt. Das führt zwangsläufig zu einem Verlust an Authentizität. Wenn selbst Drittligisten verlangen, dass wir Zitate von Spielern einreichen oder Berater ein Interview ihres Klienten vorher lesen wollen, ist die Grenze überschritten.“ Am treffendsten hat es der ehemalige „kicker“-Chef Wolfgang Uhrig ausgedrückt: „Es gilt das gestrichene Wort.“ Wo bitte soll also der Unterschied zwischen Zensur im Kommunismus und Autorisierung im Kapitalismus liegen? Es gibt keinen. „Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht“, urteilte der französisch-rumänische Autor Eugène Ionesco.
Natürlich darf man in Deutschland seine Meinung frei sagen – muss aber die Konsequenzen in Kauf nehmen. Dabei wird vor keinem Namen haltgemacht, egal wie berühmt dieser auch sein mag. Das bekam Philipp Lahm zu spüren – Weltmeister, DFB-Ehrenspielführer, Kapitän des FC Bayern, Champions-League-Sieger, Fußballer des Jahres und, und, und. Die Bayern haben in den Spielerverträgen geregelt, dass alle Interviews vor Erscheinen ihrer Pressestelle vorgelegt werden müssen. Lahm, der die Transferpolitik des Vereins kritisierte, umging das. Er ließ sein Interview unzensiert, pardon unautorisiert, in der „Süddeutschen Zeitung“ abdrucken. Dafür bekam er von den Bayern eine Strafe in Höhe von 50000 Euro aufgebrummt – die damals höchste in der Vereinsgeschichte. Doch Lahms vorbildliches Verhalten ist die berühmte Ausnahme von der Regel. Auf der Strecke bleibt das freie Wort, das von Moralaposteln, Gesinnungsakrobaten und Tugendwächtern unterdrückt wird. „Moralisten sind Menschen, die sich dort kratzen, wo es andere juckt“, erklärte der irische Schriftsteller Samuel Beckett.
Egal, ob im Kommunismus oder Kapitalismus – die meisten Journalisten wissen haargenau, was sie schreiben dürfen und was nicht. „Mögen hätt' ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut“, drückte es der Komiker Karl Valentin aus. Was Rohtraut Wittstock beim „Neuen Weg“ als Eigenzensur bezeichnete, hieß bei Jörg Dahlmann Schere im Kopf, also dasselbe. „Selbstzensur ist Stacheldraht von innen“, meinte der litauische Dichter und Aphoristiker Vytautas Karalius.
Dahlmann gehörte zu den bekanntesten Sportkommentatoren im deutschen Fernsehen (ZDF, Premiere, Sat. 1, DSF, Sport1 und Sky). 1999 wurde er vom Verband Deutscher Sportjournalisten, dem ich seit mehr als dreißig Jahren angehöre, mit dem ersten Preis im Bereich Fernsehen ausgezeichnet. „Logo, ich habe eine Zensurschere im Kopf“, gestand Dahlmann. „Aber – zugegeben – ich lasse sie oft in der Schublade.“ Was ihm zum Verhängnis wurde, als er während einer Übertragung von einem japanischen Bundesligaspieler aus dem „Land der Sushis“ gesprochen hat. Eigentlich eine unverfängliche Formulierung. Sky wertete sie jedoch als Rassismus und feuerte Dahlmann fristlos. Der populäre Reporter verstand die Welt nicht mehr: „Land der Sushis als Pseudonym für Japan ist ähnlich wie Land der Fjorde für Norwegen. Einige Leute haben daraus einen rassistischen Hintergrund gebastelt. Dass sich manch einer dem Diktat dieser Hasser beugt, macht mich sehr traurig. Es ist ein Sieg ‚sozialer Hater‘ über den freien Journalismus“. Vierzig Jahre Kommentatorentätigkeit waren mit einem Schlag vorbei.
Das Schlusswort gehört Thomas Wolf vom „FOCUS“: „Sprachverbote und Zensur vergiften die geistige Atmosphäre und lähmen die lösungsorientierte Debatte. Statt zu Offenheit und Toleranz führt politische Korrektheit zu Feigheit und Anpassertum.“ Seine mahnenden Worte ins journalistische Ohr – hüben wie drüben...
Kommen Sie gut durch die Zeit!