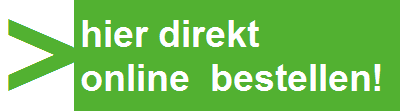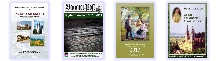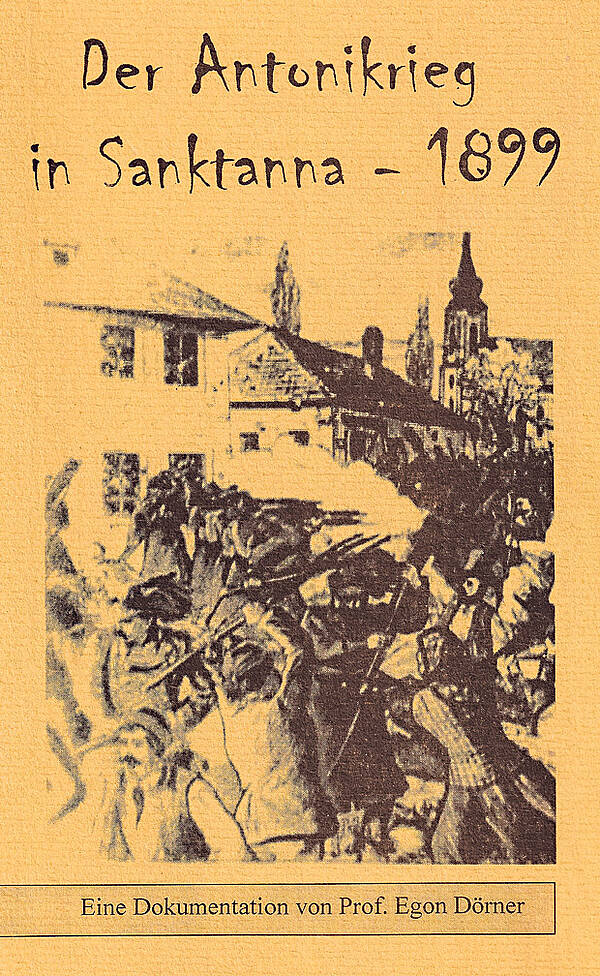Schussverletzungen mit Todesfolge waren im Banat selten. Die meisten Todesfälle durch Schusswaffen erfolgten in Kriegszeiten, seltener während der Jagd, bei Raubüberfällen, Suizid usw.
Egidius Haupt erwähnt in seiner „Geschichte der Gemeinde Sackelhausen“ (1925) einige tödliche Unfälle durch Schusswaffen. Ein Beispiel: Vitus Mikosovits war von 1780 bis 1791 Pfarrer im Ort, „welcher durch unvorsichtiges Hantieren mit dem Jagdgewehr, wobei selbes entlud und die Ladung ihm in den Kopf drang, das Leben verlor“. Er starb am 19. Januar 1792 im Alter von 45 Jahren (Josef Kühn, Familienbuch Sackelhausen, 1998, S. 355).
Jagdunfälle
Eines der ältesten Zeugnisse eines tödlichen Jagdunfalls ist ein Grabstein auf dem Friedhof in Perjamosch mit folgender Inschrift: „Halt Wan-derer! Vom Felde der Ehre mit Wunden bedekt für König und Vaterland glücklich zurückgekehrt genosz er im Zirkel Treuer Waffenbrüder der Wohlverdienten Ruhe alsz zufällig in frohe Jagdgetummel ein Schuß dem Wilde gemünzt von Freundes Hand den Freund zu Boden streckte. Er ruht sanft Dir aber Wanderer diene dieses Denkmahl von einer trauernden Mutter erbaut zur belehrender Warnung, gestorben den 14ten October 1811, Alt 32 Jahr“.
Im Perjamoscher Heimatbrief (Folge 13/Mai 1988) heißt es: „Am 16. Oktober 1811 wurde in Perjamosch Rittmeister Karl Dahlmiller von einem Regimentskaplan beerdigt“. Im Familienbuch Perjamosch von Anton Krämer erscheint der Name Dahlmiller jedoch nicht.
Karl Weber aus Kleinsiedel ist am 1. Januar 1903 im Alter von 33 Jahren gestorben. Er war Jäger und fuhr mit dem Schlitten auf die Jagd, um etwas für den Neujahrstisch zu schießen. Weber hat sich unverhofft selbst erschossen. Das geladene Gewehr zwischen seinen Füßen hatte sich plötzlich entladen.
Ein unvorsichtiger Schuss während der Jagd beendete 1929 das Leben des 50-jährigen Peter Thees aus Moritzfeld. Johann Filippi aus Mercydorf, 36 Jahre alt, wurde 1930 während der Jagd erschossen.
Ein Grabstein auf dem Friedhof von Großsanktpeter trägt folgende Inschrift: „Hier ruhet unser unvergeßlicher Sohn Anton Krohn, verunglückt 21. November 1930, 14 Jahre alt. Tief betrauert von Eltern, Geschwistern, Großeltern und Verwandten. Ohne Schmerz und ohne Träne bist du geschieden, / Schmerz und Qual ist für uns geblieben, /Unschuldig mußt du in den Tod hinein, / Hoffentlich wirßt du auch im Himmel sein“. Die Zeitzeugin Elisabeth Friedrich, geb. Martin (1906-1995), wusste zu berichten, dass Anton Krohn auf der Jagd vom Gendarmen Plăcintar versehentlich erschossen wurde.
Der „Antonikrieg“ in Sanktanna
Sechs Menschenleben forderte der „Antonikrieg“ (auch „Weiberkrieg“ oder „Bauernrevolte“ genannt) von 1899 in Sanktanna. Es war keine organisierte Revolte, es war einfach ein „Krieg im Sinne von Streit zwischen der Dorfobrigkeit (Richter) und der aufgebrachten Bevölkerung von Sankt-anna“, schreibt Jakob Hübner in der „Monographie der Großgemeinde Sanktanna“.
Worum ging es eigentlich? Die Großbauern hatten ihre Pusztas, wo sie ihr Vieh hielten. Sie wollten die Hutweide, von der sie nicht abhängig waren, aufackern und unter sich aufteilen. Die ärmeren Bevölkerungsschichten protestierten dagegen, da sie für ihr Vieh auf die Dorfweide angewiesen waren.
Der damalige Dorfrichter war Josef Jestl. Es war der 17. Januar 1899 (Antonitag), ein Markttag, als die Frauen das Gemeindehaus stürmten und die ins Rathaus gerufenen vier Gendarmen in arge Verlegenheit brachten. Da gab der Patrouillen-Kommandant Stefan Molnar plötzlich den Feuerbefehl. Es fielen Schüsse. Zwei Männer und zwei Frauen brachen tot zusammen: Andreas Zöllner, 33 (aus Altsanktanna), Michael Kemmerle, 65, Katharina Hellstern, geb. Schneider, 53 und Barbara Marksteiner, geb. Baumann, 35.
Andreas Müller erhängte sich, er war das fünfte Opfer des „Antonikrieges“. Das sechste Opfer war die 25-jährige Anna Teuber, die nach elftägigem Ringen um ihr Leben am 28. Januar 1899 ihren Verletzungen erlag.
In der Dokumentation „Der Antonikrieg in Sanktanna – 1899“, erschienen 1974 in der „Neuen Banater Zeitung“ (30 Folgen) und als Broschüre 1999 in Freiburg, schildert Egon Dörner detailliert die Ereignisse von damals.
Die „Sieben von Hatzfeld“
Über den siebenfachen Mord im September 1944 in Hatzfeld schreibt Thomas Breier im Heimatbuch Hatzfeld (1991, S. 261-262): „In der Nacht vom 14. auf den 15. September pochten die Naziagenten an der Haustüre von Mathias Schmidt. (…) Schmidt versuchte durch das Fenster zu flüchten, wurde aber von den Schüssen einer Maschinenpistole getroffen. Dann stürzten sich die Naziagenten auf den Schwerverwundeten und töteten ihn mit Bajonettstichen. Johann Lehoczky wurde eine Handgranate ins Zimmer geworfen, die ihn tödlich verletzte. Ein Rollkommando (…) verhaftete dann Johann Keller, Ferdinand Koch, Johann Farle, Nikolaus Petri und Peter Höfler. Am Nachmittag des 15. September 1944 erschoß man die fünf Freiheitskämpfer neben der Panonia-Mühle. (…) Sechs Wochen später, am 26. Oktober 1944, fanden die Trauerfeierlichkeiten auf dem Friedhof von Jimbolia statt“.
In dem Drama „Narrenbrot“ schildert Hans Kehrer die Ereignisse vom September 1944 in Hatzfeld.
Im Spätsommer 1945 wurden die Ebendorfer Elisabeth Buika, geb. Netzer und Philipp Müller in einem Maisfeld an der Lugoscher Straße erschossen aufgefunden. Sie waren in Lugosch und sind nicht mehr heimgekehrt. Nach drei Tagen hat man ihre Leichen entdeckt. An der Stelle, wo sie ermordet wurden, steht ein Holzkreuz. (Heinrich Lay, Ebendorf im Banat. Monographie und Heimatbuch, 1999, S. 242)
Nachkriegs-Tragödien an der Grenze
Viele Banater Schwaben, darunter auch ehemalige Soldaten und Kriegsgefangene, wollten unbedingt in ihre Heimat zurückkehren. Auch Personen, die aus Titos Vernichtungslagern entkommen sind, haben versucht, „illegal“ nach Rumänien zu gelangen. Oft hatte eine Grenzerkugel diese Hoffnung jäh zerstört und viele haben ihren Mut, wieder zurück in die Heimat zu gelangen, mit dem Leben bezahlt. Ihre Gräber in grenznahen Orten sind stumme Zeugen einer unheilvollen Zeit.
Viele Heimkehrer wurden an der Grenze bei Tschanad erschossen. In der Sterbematrikel von Tschanad sind folgende Bakowa-Heimkehrer verzeichnet, die am 30. August 1947 an der ungarisch-rumänischen Grenze erschossen wurden: Michael Pettla (geb. 1901), Georg Ringler (geb. 1904), Georg Ringler (geb. 1923), Maria Fischer, geb. Raschko (geb. 1924), Maria Garand, geb. Fischer (geb. 1920), Eva Duckhorn, ledig (geb. 1926) und Katharina Richter, geb. Gilbert (geb. 1921).
Georg Ringler sen. und jun. wurden in Tschanad beigesetzt. Ihr Grabstein trägt folgende Inschrift: „Georg Ringler und sein Sohn Georg aus Bacova, beide gestorben 31. August 1947. Vater 44 Jahre alt, Sohn 24 Jahre alt. Am Morgen waren wir frisch und rot, / Und am Abend nahm uns schon der Tod“.
Die Tschanader Matrikel dokumentieren auch den Tod des Hutfabrikanten Nikolaus Korber, geboren 1883 in Großsanktnikolaus, wohnhaft in Perjamosch, der am 30. Januar 1949 an der Grenze erschossen wurde.
„In den Tod geflüchtet“ heißt die Überschrift eines Beitrags, erschienen in der Wochenzeitung „Der Donauschwabe“ vom 15. März 1981. Auf dem Friedhof von Kleinkomlosch/Ostern gibt es das Grab (Metallkreuz) zweier Frauen, nämlich Mutter und Tochter Anna und Maria aus Botschar, jugoslawisches Banat. Die beiden Frauen flohen in der bitterbösen Zeit (1947) aus Titos Reich über die Grenze nach Rumänien, liefen hier aber einer rumänischen Patrouille direkt in die Hände. Man nahm sie gefangen und sperrte sie ein. Tags darauf wurden sie von einem übereifrigen rumänischen Korporal erschossen. Der Kerl wollte sich den „Kopflohn“ verdienen, der in Sonderurlaub bestand.
Nikolaus Horn gibt im Familienbuch Ostern (2007, S. 571) laut Sterbematrikel als Todestag von Anna und Maria Koch den 29. August 1947 und als Todesursache „als Grenzüberläufer erschossen“ an.
Ein Fluchtopfer aus Moritzfeld
Gerlinde Scherter berichtet in ihrem Buch „Die unsichtbaren Fesseln“ (2012, S. 857) auch über ihre Teilnahme an einem Moritzfelder Treffen in Donaueschingen. Gerlinde war von 1949 bis 1957 Lehrerin in Moritzfeld. Sie schreibt: „Die Stimmung der Gäste ist sehr gut. Nur eine Frau fällt Gerli auf, sie ist sehr ernst und in etwas bedrückter Stimmung. Sie erfährt, dass es eine ehemalige Schülerin von ihr ist, deren Sohn beim Flüchten über die rumänisch-jugoslawische Grenze erschossen wurde“.
Bei dem Opfer handelt es sich um meinen ehemaligen Schüler Gerhard Belgrasch, der aber nicht an der rumänisch-jugoslawischen, sondern an der jugoslawisch-österreichischen Grenze zu Tode gekommen ist. Er wurde von jugoslawischen Grenzposten am 1. Dezember 1984 bei Maribor (Marburg an der Drau) erschossen. Geri wurde zwar angeschossen, seine Verletzungen waren aber nicht tödlich. Er ist auf tragische Weise, weil ohne medizinische Hilfe, einfach verblutet. Unfassbar! Gerhard, ein lieber und lebensfroher Mensch, war gerade mal 21 Jahre alt. Sein Leichnam wurde von Hans Jung geborgen und nach Moritzfeld überführt, wo er am 13. Dezember 1984 beigesetzt wurde.
Ein Leben im Westen in Würde und Freiheit hat die jungen Menschen dazu verleitet, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Stellt sich nur die Frage, ob es sich wirklich lohnte, die gefährliche Flucht zu wagen, wenn man dadurch sogar sein Leben aufs Spiel setzte. Das war aber eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen und verantworten musste.
Vergiftet und erstickt
Wenn jemand im Banat unter Gifteinwirkung ums Leben kam, so handelte es sich dabei vorwiegend um Suizide oder um Vergiftungen, die aus Unachtsamkeit geschahen. Serienmörderinnen wie Gesche Gottfried (1785-1831) aus Bremen, die durch Arsenik 15 Menschen vergiftete, hat es im Banat nicht gegeben, aber folgende in der „Dettaer Zeitung“ vom 1. November 1896 veröffentlichte Nachricht macht betroffen: „Wie man aus Csákova schreibt, wurde das Stubenmädchen des Hotel ‚Rössel‘, Rosa Wallner, ein schönes 17-jähriges Mädchen von einer älteren Dame, welche oft im Hotel verkehrte, vergiftet“.
Laut der Sterbematrikel von Gottlob ist der einjährige Nikolaus Roth 1925 an einer „Vergiftung durch Lauge“ gestorben. Bei Wilhelm Rupprecht aus Josefsdorf, gestorben 1944 im Alter von 61 Jahren, ist als Todesursache „unverhofft Steinsoda getrunken“ angegeben.
Bei den Eheleuten Franz Schleich (60) und Katharina Schleich, geb. Schleich (54) aus Triebswetter ist in der Sterbematrikel folgende Todesursache vermerkt: „Die Eheleute kamen am 7. Oktober 1931 durch Erstickung infolge Kellergase um“. Über einen ähnlichen Fall aus Deutschsanktpeter berichtet die „Dettaer Zeitung“ vom 9. Oktober 1932: „Der gesunde 68jährige Landwirt Stefan Berenz hat auf tragische Weise den Tod gefunden. Er begab sich in den Weinkeller, dortselbst waren starke Lager hochgärenden Mostes. Von der ausströmenden Kohlensäure wurde Berenz betäubt und fiel zu Boden, um nie wieder aufzustehen. Als man ihn auffand, war er bereits tot. Der Arzt stellte Erstickung fest“.
Im September 1936 ist der 83-jährige Franz Vogel aus Engelsbrunn durch Brunnengase „im Brunnenschacht erstickt“. Im Brunnenschacht kann zum Beispiel Kohlendioxid durch Fäulnis von Planzenteilen entstehen.
Es gab auch einzelne Fälle von Vergiftungen durch Kohlengas. So zum Beispiel starb am 8. Januar 1971 der Schofför Johann Fitz (geb. 1947) aus Marienfeld an einer „Vergiftung durch Kohlenmonoxid in der Autogarage“, so die Sterbematrikel. In Lenauheim wurden die Eheleute Mathias Kirsch (geb. 1901) und Margarethe, geb. Rosenhoffer (geb. 1899) am 21. Februar 1983 tot aufgefunden. Sie starben höchstwahrscheinlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung (Ofengas).
Die 61-jährige Elisabeth Schulz aus Neudorf starb 1974 an einer „Kohlenvergiftung“. Als Todesursache der Eheleute Franz und Anna Schrimpf, geb. Hoff aus Karansebesch im Dezember 1965 wird in der Sterbematrikel „vergiftet mit Kohlengas“ angegeben.
Es ist auch vorgekommen, dass jemand gewollt (bei Suizid) oder aus Versehen „Kartoffelspritzsach“ (Insektizid zur Bekämpfung des Colorado-Käfers) getrunken hat. Auf diese Art und Weise starben Josef Leiser (1930-1967) aus Neusanktanna und Peter Agnes (1936-1971) aus Deutschbentschek.
Dr. Jakob Franz Koch aus Pesak beging im Alter von 47 Jahren am 11. Dezember 1945 „Selbstmord durch Vergiftung“ (Totenmatrikel Triebswetter). An einer Vergiftung starb 1948 auch Johann Gumper (57) aus Neubeschenowa.
Der dreijährige Stefan Brucker aus Josefsdorf hat sich 1933 mit Essigsäure vergiftet. Auf dem Friedhof in Birda steht der Grabstein der Magdalena Gärtner, geb. Hack, gestorben 1948, 23 Jahre alt. Laut mündlicher Aussage hat sie in der Apotheke statt Bittersalz (Magnesiumsulfat) ein giftiges Mittel (Kleesalz) erhalten. Kleesalz, auch Bitterkleesalz genannt, ist ein giftiges Kaliumsalz der Oxalsäure und ist ein Fleckenbeseitigungsmittel.