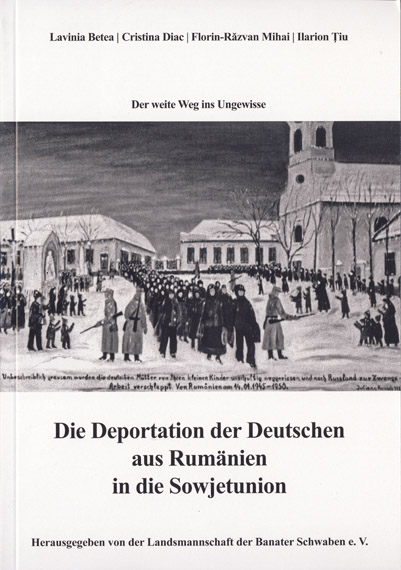Aus dem Internierungslager im Donbass kam ich unglücklicherweise im Herbst des Jahres 1946 in ein russisches Arbeitslager im Ural, ca. 200 Kilometer nördlich der Stadt Solikamsk. Als einziger Deutscher in der Arbeitsbrigade, auf mich allein gestellt, befand ich mich in einer hoffnungslosen, verzweifelten Lage. Vergebens suchte ich nach einem Menschen, mit dem ich hätte sprechen können.
Es war an einem Sonntag. Ich lag auf meiner blanken Pritsche, als ich einem Gespräch von Mitinternierten entnehmen konnte, dass es im Nebenraum eine Art Nähstube gäbe, wo man Nadel und etwas Zwirn bekäme. Da meine Handschuhe Löcher hatten und das bei der grimmigen Kälte gefährlich war, versuchte ich mein Glück. Ich trat in den kleinen Raum ein. Auf einem Stuhl saß ein etwa 50 Jahre alter Mann und nähte. Er war für das Kleiderflicken zuständig, eine privilegierte Stellung im Lager, zumal er bei der klirrenden Kälte keine schweren Waldarbeiten verrichten musste. Soweit ich mich erinnere, war er der einzige, der nicht kahl geschoren war im Lager. Wie ich später erfahren sollte, war der Mann ein Prediger, eine hochintelligente Person, die alle Lagerinsassen mit „Gospodin“ (Herr) ansprachen.
Und nun folgte in der Nähstube ein für mich hochinteressantes und total unerwartetes Gespräch, nachdem mein Gegenüber merkte, dass ich kein Russe bin. „Woher kommen Sie?“, wollte er wissen. „Aus Rumänien“, antwortete ich, ebenfalls auf Russisch. Aus welcher Gegend ich denn käme, hakte er nach. „Aus Temeswar“, war meine Antwort. Ich merkte, dass mich der gute Mann ziemlich verstört ansah. „Unmittelbar aus Temeswar?“, fragte er. „Nein, sondern aus dem Ort Busiasch“, präzisierte ich.
Plötzlich starrte mich der Mann an und sagte in einwandfreiem Rumänisch: „Sie kommen tatsächlich aus Busiasch? Ich war oft in Busiasch.“ Sogleich legte er den Finger auf den Mund und gab mir dadurch zu verstehen, dass wir leise sein sollten. Man versetze sich nun in meine Lage: Unterernährt, total erschöpft infolge schwerster Waldarbeit, und nun diese aufmunternde, vielleicht auch hoffnungsvolle Begegnung. Er verriegelte die Tür und begann mir seinen Leidensweg zu erzählen.
Als der Rückzug der deutschen und rumänischen Truppen Anfang des Jahres 1944 fast chaotisch verlief, zog er mit einer rumänischen Einheit über Odessa nach Rumänien und gelangte bis in das Banat. Unter welchen Umständen er in die etwa zehn Kilometer von Busiasch gelegene Ortschaft Racoviţa gelangte, weiß ich nicht mehr genau. Auf alle Fälle fand er als Flüchtling Aufnahme bei dem dortigen rumänisch-orthodoxen Pfarrer namens Stanca und dessen Familie. So lassen sich auch seine Rumänischkenntnisse erklären.
Zu meiner größten Überraschung erfuhr ich, dass er des Öfteren samstags mit der Kutsche in Begleitung des Pfarrers auf den Wochenmarkt nach Busiasch kam und unter anderem in einer Seilerwerkstätte Hanfutensilien kaufte. Diese Werkstätte befand sich in meinem Elternhaus, wo ich bis zu meiner Verhaftung und Verschleppung im Januar 1945 lebte. Da der Pfarrer mit meinem Vater gut bekannt war, verriet er ihm, dass sein Begleiter ein Russe sei. Auch ich wurde in dieses Geheimnis eingeweiht. Nun die große Überraschung in der Nähstube: Der Mann konnte sich an mich erinnern und auch ich erkannte den schmächtigen, hochgewachsenen Russen mit dem Spitzbart, den er auch noch im Lager trug. Es war der Beginn einer seltsamen Freundschaft in der sibirischen Taiga.
Eines Tages, erzählte er weiter, sei das Haus des Pfarrers früh am Morgen von russischen Soldaten umzingelt worden. Gospodin Kiseleff, so hieß der Mann, wurde verhaftet, nach Konstanza gebracht und landete dann in Solikamsk, Endstation der Eisenbahnlinie im Ural. Es war ein riesiges Sammellager, von wo aus Gruppen von 30-40 Personen die Strecke bis in das zugeteilte Arbeitslager zu Fuß zurücklegen mussten.
Dieser Bekanntschaft verdanke ich zweifellos meine Rettung vor dem Hungertod. Es entstand eine enge, vertrauliche, aber auch geheime Freundschaft zwischen uns beiden, wobei Gospodin Kiseleff eine Art väterliche Rolle spielte. Anlässlich unserer Zusammenkünfte in der Nähstube, meist abends, wenn es keinen Zugang zur Stube mehr gab, bekam ich immer eine Portion „Kascha“ (Haferbrei) und einige Brotscheiben. Er war nämlich mit dem Lagerkoch Nikolai Petrowitsch gut befreundet. Es war für mich ein Segen Gottes in dieser verdammten Taiga, wo es nichts als Arbeit, Hunger, die blanke Pritsche gab und man selbst die Zeitrechnung oft verloren hatte.
Eines Abends fragte er mich, ob ich denn wisse, was heute sei. Es war Heiligabend 1947. Wir gingen beide ins Freie und unter sternklarem Himmel beteten wir das Vaterunser rumänisch, dazu sprach er auch einige geistliche Worte. Ich vergrub mein Gesicht in meine Steppjacke und meine Gedanken führten mich in eine ferne Welt, wo ich einst glücklich war.
Eines Abends, als ich wieder in die Nähstube trat, traf ich eine fremde Person. Mein Freund und Beschützer war in ein anderes Lager versetzt worden und ich hatte für immer einen wahren Freund verloren. Weinend legte ich mich auf meine blanke Pritsche. Keinem Menschen konnte ich erzählen, was ich verloren hatte.